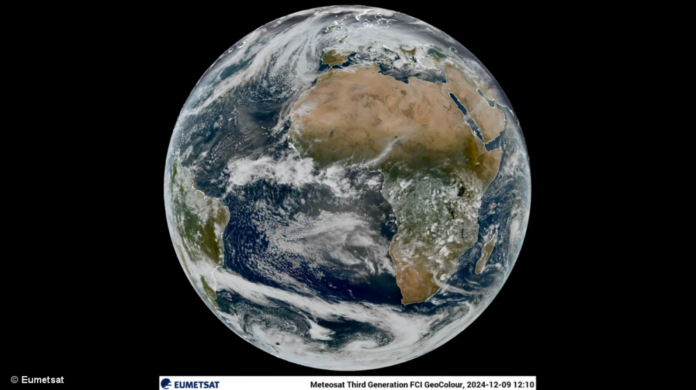
Wer hat es gemerkt? Der 22. Juli 2025 war einer der kürzesten Tage, seit sich die Menschheit auf die Zeitmessung versteht. Was sind die Hintergründe?
Kürzester Tag? Mitten im Sommer?
Hier geht es nicht um die Sonnenscheinstunden während eines Tages, sondern um die Erdrotation. Eine Umdrehung der Erde um exakt 360 Grad entspricht bekanntlich 24 Stunden. Eine Konstante, wie man meinen würde. Doch dem ist nicht so. Unsere Erde dreht sich mal schneller, mal langsamer. Diese Abweichungen bewegen sich in derart kleinem Rahmen, dass sie von der Menschheit unbemerkt bleiben. Messbar sind sie allerdings schon und diese Schwankungen können weitreichende Folgen nach sich ziehen.
Um wie viel kürzer war der 22. Juli 2025?
Im Durchschnitt ist ein Tag 86.400 Sekunden lang. Der 22. Juli 2025 war etwas kürzer. Um wie viel, darüber scheiden sich noch die Geister. Konkret redet man von einer Zeitspanne von 1,34 bis 1,51 Millisekunden. Der Rekord an einem zu kurzen Tag wurde erst vor etwa einem Jahr, konkret am 5. Juli 2024, mit 1,66 Millisekunden aufgestellt.
Wie kann das sein?
Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Sie sind astronomischer und geophysikalischer Natur. Dazu zählen:
- Am 22. Juli befand sich der Mond besonders weit vom Erdäquator entfernt. Womit er die Erdumdrehung weniger bremste, als gewöhnlich.
- Das Weltwetter wirkt sich auf die Erdrotation aus. Stichwort Wetterströmungen.
- Auch Bewegungen im flüssigen Erdkern beeinflussen die Rotationsgeschwindigkeit.
- Masseverschiebungen, etwa durch schmelzende Gletscher, Erdbeben oder Vulkanausbrüche, führen zu Masseverschiebungen, die ebenfalls auf die Erdrotation Auswirkungen haben.
Was sind die Folgen?
Die exakte Zeitbestimmung ist elementar bei der Positionsbestimmung. Das weiß man seit Jahrhunderten in der Seefahrt. Heute stellen Schwankungen im Bereich von 1 bis 2 Millisekunden unter anderem nicht zu unterschätzende Probleme bei der Satellitennavigation dar, die zu markanten Fehlern in der Positionsbestimmung führen können.
Weiter ist für die Raumfahrt die exakte Zeit extrem wichtig. Da hier bereits die geringsten Abweichungen nicht reparierbare Folgen nach sich ziehen können, wird in ihr mit der Atomzeit gearbeitet. Weiter sind hochpräzise Zeitstempel das um und auf im Finanzwesen und der Telekommunikation. Dabei geht es um Börsentransaktionen und Datenübertragungen,
Lassen sich diese Ungenauigkeiten reparieren?
Ja. Und zwar mit einer Schaltsekunde. Schaltsekunden können bis zu zweimal im Jahr, am 30. Juni oder 31. Dezember, eingefügt werden. Seit 1972 wurden bereits 27 Schaltsekunden eingefügt. Für die Zeitmessung bedeutete das stets, dass nach 23:59:59 Uhr, 23:59:60 Uhr und dann erst 00:00:00 Uhr folgte. Wann es die nächste Schaltsekunde geben wird, ist unklar. Hingegen fest steht, dass sie ab 2025 durch eine Schaltminute ersetzt werden soll.
Außerdem interessant:






